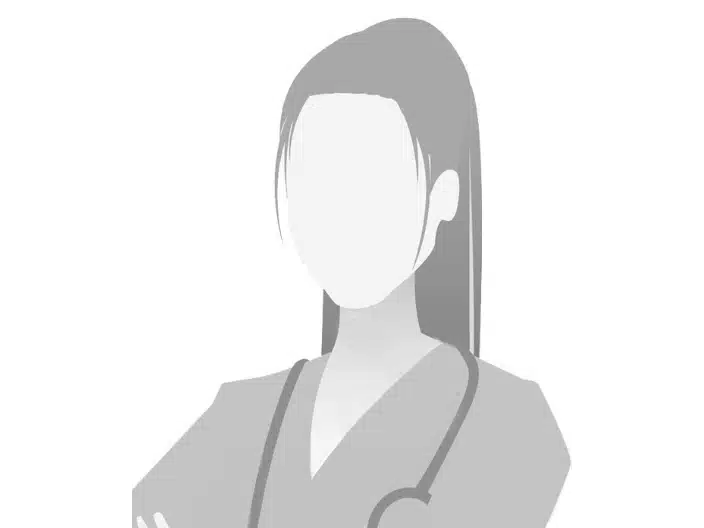Man versteht unter Hammerzeh oder Krallenzeh Fehlstellungen der Zehen II – V mit übermäßiger Beugung und Bewegungseinschränkung der Zehengelenke. Dadurch kommt es zu Konflikt am Schuh und zu schmerzhaften Schwielen.
Dieser Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen nach aktuellem wissenschaftlichen Stand zu Aufklärungszwecken bereitgestellt. Er dient der medizinischen Aufklärung und nicht zur Selbstdiagnose. Er ersetzt keine Vorstellung bei einem Facharzt.
Inhaltsverzeichnis
Zehenanatomie
Jeder Zeh (außer die Großzehe) hat drei Knochen: Grund-, Mittel- und Endglied. Diese bilden zusammen jeweils drei Gelenke: Grund- (MTP), Mittel- (PIP) und Endgelenk (DIP). Diese Gelenke bewegen sich nur in einer Ebene; das bedeutet sie können nur gestreckt oder gebeugt werden.
Die Zehenbeweglichkeit wird durch den Zug verschiedener Muskeln über Sehnen gesteuert. Jeder Zeh hat 2 Strecksehnen und 2 Beugersehnen:
- die lange Strecksehne (med. Extensor digitorum longus, EDL) – setzt sich auf Mittel- und Endglied an und streckt sowohl das MTP, das PIP als auch das DIP. Sie trägt in der Schwundphase des Gehens zu der Streckung des Sprunggelenkes bei.
- die kurze Strecksehne (med. Extensor digitorum brevis, EDB) – setzt sich auf Grundglied an und ist ein kräftiger Strecker des MTP.
- die lange Beugersehne (med. Flexor digitorum longus, FDL) – setzt sich auf Endglied an und beugt sowohl das PIP als auch das DIP.
- die kurze Beugersehne (med. Flexor digitorum brevis, FDB) – setzt sich auf Mittelglied an und beugt lediglich das PIP.
Auf beiden Seiten des Zehs verlaufen jeweils zwei Nerven mit begleitenden Gefäßen.
Welche Kleinzehenfehlstellungen gibt es?
Ein normaler Zeh ist unter Belastung gerade und seine drei Gelenke sind frei beweglich. Die folgenden Zehenfehlstellungen zeigen eine übermäßige Beugung und/oder Streckung eines oder mehrerer Gelenke.
Oft besteht Unterschiede in der Nomenklatur dieser Zehenfehlstellungen. In den verfügbaren Informationsquellen für die Patienten werden verschiedene Begriffe für die gleiche Fehlstellung benutzt. Hier eine Erklärung der drei wichtigsten Fehlstellungen der kleinen Zehen (en. Lesser toe deformities) auch mit den entsprechenden englischen Begriffe:
Was ist eine Hammerzehe?
Bei der Hammerzehe (en. Hammer toe, lat. Digitus malleus) beurgt sich das Zehenmittelgelenk (PIP), während das Zehenendglied nach unten zeigt. Das bedeutet, das PIP ist gebeugt, DIP und MTP sind normal. Beim Hammerzeh besteht eine Verkürzung des FDBDiese abnormale Position erinnert an die Form eines Hammers, was der Deformität ihren Namen gibt.
Hammerzehen können in verschiedenen Zehen auftreten, aber sie sind besonders häufig in den zweiten, dritten oder vierten Zehen. Diese Zehendeformität kann schmerzhaft sein und zu Hühneraugen, Schwielen und Druckstellen führen.
Was ist eine Krallenzehe?
Bei der Krallenzehe (Klauenzeh, en. Claw toe) ist eine Zehendeformität, bei der die Zehen sich in einer charakteristischen Weise krümmen, was der Form von Vogelkrallen ähnelt. Hier sowohl das Zehenmittel- (PIP) als auch -endgelenk (DIP) gebeugt und das Zehengrundgelenk (MTP) streckt. Im Gegensatz zur Hammerzehe besteht hier zusätzlich eine Verkürzung der Strecksehnen.
Diese Deformität betrifft oft alle Zehen und assoziiert sich oft mit einer Hohlfußfehlstellung. Die Krallenzehe kann verschiedene Grade der Krümmung aufweisen. Im mildesten Fall ist die Zehe leicht gebogen, während in fortgeschritteneren Fällen das Endglied stark nach oben gebogen ist und das Mittelgelenk nach unten zeigt. Diese Deformität kann zu Schmerzen führen, besonders wenn der Druck auf die Zehen durch Schuhe erhöht wird. Darüber hinaus können Druckstellen, Schwielen oder Hühneraugen auftreten, insbesondere an den Stellen, an denen die Zehen gegen das Schuhwerk reiben.
Was ist eine Malletzehe?
Bei der Malletzehe (en. Mallettoe) ist eine Zehendeformität, bei der das Endglied einer Zehe nach unten gebogen ist. Im Wesentlichen bleiben das Grund- (MTP) und das Mittelgelenk normal, aber das Endgelenk (DIP) zeigt eine übermäßige Beugung, die dem Aussehen eines Hammers oder Mallets ähnelt. Hier ist die lange Beurgersehne (FDL) verkürzt.
Diese Deformität tritt selten, auf. Am häufigsten ist die 2. Zehe betroffen.
Welche anderen Kleinzehenfehlstellungen gibt es?
Neben Hammerzehen, Krallenzehen und Mallet-Zehen gibt es verschiedene andere Kleinzehenfehlstellungen, die aufgrund von anatomischen oder biomechanischen Problemen entstehen können. Hier sind einige weitere Arten von Kleinzehenfehlstellungen:
- Schneiderballen (med. Digitus quintus varus, en. Bunionette, Tailor’s Bunion): Ähnlich wie ein Hallux valgus, aber an der äußeren Seite des Fußes. Es handelt sich um eine Vorwärtsverlagerung des fünften Mittelfußknochens, begleitet von einer Druckstelle und Schwellung.
- Überlappende Zehen (usg. Reiterzehe, Kreuzzehe, en. Cross toe): Eine Deformität, bei der eine Zehe über oder unter einer benachbarten Zehe liegt. Dies kann Reibung und Druck verursachen.
- Lockenzehe (en. Curly toe): eine Zehenfehlstellung mit Überbeugung des Mittelgelenks und gleichzeitiger Außenrotation.
Warum entstehen die Zehenfehlstellungen?
Die Hammerzehen entstehen durch ein Ungleichgewicht der Fußmuskeln. Beim normalen Zeh arbeiten die Streck- und Beugermuskeln zusammen und führen den Zeh in Beugung oder Streckung. Wenn dieses Zusammenspiel aus verschiedenen Gründe gestört wird, wird auf den Zeh Zug in einer Richtung ausgeübt und führt zu einer Fehlstellung.
Ein Grund dafür ist das Tragen von unpassendem Schuhwerk. Schuhe mit enger Spitze drücken die Zehen in einer gebeugten Stellung. Wenn der Zeh eine verlängerte Zeit in solcher Position gehalten wird kommt es zu einer Verkürzung der Sehnen und zu Fixierung des Zehs in dieser Stellung. Die Zehen reiben am Schuh und entstehen Schwielen, welche die Schmerzen verschlechtern. Hohe Schuhe zwingen den Fuß nach unten, die Zehen werden gegen den Schuh gedrückt und die Zehenbeugung wird verstärkt.
Oft wird das Schuhwerk für die Entstehung der Krallenzehen beschuldigt. Jedoch entstehen diese öfters infolge einer Nervenproblematik, die von Krankheiten wie Zuckerkrankheit (med. Diabetes mellitus), Alkoholismus verursacht wird. Diese Krankheiten schwächen die Fußmuskeln und führen zum o.g. Muskelungleichgewicht. Die Krallenzehen drücken sich in den Schuhsohlen und führen zur Fußsohlenschwielen.Andere Ursachen für Krallenzehen sind: das Kompartmentsyndrom, die Polyneuropathie, verschiedene Beinlähmungen usw. Oft entstehen Krallenzehe beim Hohlfuß (med. Pes cavovarus) auch infolge einer neurologischen Störung.
Fehlstellungen der Großzehe (z.B. Hallux valgus) zwingen den zweiten Zeh zur Überstreckung (med. Digitus secundus superductus). Nach längerer Zeit verkürzen die Beugersehnen und die Fehlstellung bleibt kontrakt. Entzündungen der Zehengelenke (z.B. im Rahmen rheumatoider Erkrankungen) zerstören die stabilisierenden Gelenkbänder und -kapsel und führen zu Zehenfehlstellungen.
Beim Mallet toe findet man oft ein Unfall und der Vorgeschichte. Diese Fehlstellung ist demzufolge oft eine Unfallfolge mit DIP-Gelenkschädigung. Andere Ursachen sind Zehen-Wachstumsstörungen im Kinderalter mit vermindertem Wachstum des unteren Gelenkanteil.
Symptome
Die Hammer- und Krallenzehe nehmen durch die Beugestellung an Höhe zu, dadurch kommt es zur Reibung am Schuh. An den Reibungsstellen entwickeln sich Hühneraugen (med. Clavus). Der Druck des Schuhs auf die gebeugten Zehen wird auf den Mittelfußknochen weitergeleitet und führt zur Bildung von Fußsohlenschmerzen (med. Metatarsalgie).
Welche Untersuchungen sind bei Hammerzehen notwendig?
Für die Diagnose von Hammerzehen erfolgt in der Regel aufgrund der sichtbaren äußeren Symptome und einer Anamnese des Patienten (Anamnese und klinische Untersuchung). Weitere notwendigen apparative Untersuchungen unfassen die Röntgendiagnostik, Pedobarographie und selten Schichtbilddiagnostik (MRT oder CT).
Anamnese und klinische Untersuchung
Eine klinische Untersuchung umfasst die Beobachtung der Zehenstellung sowohl in sitzender als auch stehender Position. Hier wird die Stellung der Zehe als auch mögliche Druckstellen und Schwielen über den Gelenken durch Reibung am Schuh beobachtet.
Zunächst wird die Gelenkbeweglichkeit überprüft. Dies wird sowohl beim hängenden Fuß (mit entspannter Muskulatur) als auch im Stehen überprüft. Ein hilfreicher Test ist der “Push off Test”. Dadurch wird durch Druck auf den Mittelfußköpfchen von der Fußsohlenseite die Belastung simuliert und eine Verkürzung der Beugermuskulatur zur Erscheinung gebracht.
Durch eine gründliche klinische Untersuchung kann man der Unterschied zwischen flexible und fixierte Hammerzehe machen. Diese Information hat eine große therapeutische Relevanz.
Bei Krallenzehen kann man rein klinisch die verkürzten und bei Beugestellung der Zehengrundgelenke angespannten Strecksehnen erkennen.
Ausgeprägte Krallenzehe können als Folge einer degenerativen Verrenkung des Grundgelenks (med. Gelenkluxation) entstehen. Hier kann man klinisch das nach oben versetzte Grundgliedbasis tasten und die Instabilität des Gelenkes durch einen sog. Schubladentest darstellen.
Röntgenuntersuchung
Eine Röntgenuntersuchung des Fußes in 2 Ebenen ist immer erforderlich. Diese muss, wie bei allen Fußfehlstellungen, obligat unter Belastung (im Stehen) erfolgen.
Dabei kann man das Verhältnis der Gelenkpartner in allen Zehengelenke untersuchen und eventuelle Gelenkluxationen identifizieren. Man kann auch Gelenkschäden (z.B. bei ursächlicher rheumatoider Arthritis, Gicht oder Infektionen) erkennen.
Die Röntgenuntersuchung dient auch der Identifizierung und Beurteilung begleitender Fehlstellungen, wie Hallux valgus, Hallux rigidus, Schneiderballen, Hohlfuß, Knick-Senkfuß, Klumpfuß usw., die man oft im Behandlungskonzept integrieren muss.
Ganganalyse und Fußdruckmessung (Pedobarographie)
Die Pedobarographie ist eine diagnostische Methode, die die Druckverteilung unter den Füßen misst. Diese Untersuchung kann bei verschiedenen Fußproblemen, einschließlich Hammerzehen, eingesetzt werden, um Einblicke in die Fußmechanik und die Belastung während des Gehens zu gewinnen.
Die Untersuchung kann zeigen, an welchen Stellen unter den Füßen der höchste Druck während des Gehens auftritt. Bei Hammerzehen können dies Bereiche sein, an denen der Zehenknick in engen Schuhen Reibung und Druck verursacht.
Die Pedobarographie kann Abweichungen im Gangmuster aufzeichnen, die durch die Deformität der Zehen verursacht werden. Dies kann dazu beitragen, herauszufinden, wie sich Hammerzehen auf die allgemeine Gangdynamik auswirken.
Die Messungen zeigen, wie die Belastungsverteilung auf die verschiedenen Bereiche des Fußes erfolgt. Dies kann bei der Planung von Maßnahmen zur Druckentlastung und Unterstützung des Fußes hilfreich sein.
MRT oder CT
In der Regel wird für die Diagnose von Hammerzehen oder anderen Zehendeformitäten kein MRT (Magnetresonanztomographie) oder CT (Computertomographie) durchgeführt.
MRT wird häufiger für die Untersuchung von Weichteilstrukturen und Gelenken verwendet, um detaillierte Bilder von Muskeln, Sehnen, Bändern und anderen Geweben zu erhalten. CT stellt besser die Knochenstruktur sowie das Verhältnis der kleinen Fußknochen zueinander dar.
Diese sind zum Ausschluss von verschiedenen begleitenden Erkrankungen, wie z.B. Morton Neurom, rheumatoide Gelenkentzündungen, Knochenbeteiligung bei Infektionen (med. Osteolyse), Frakturen (ugs. Knochenbrüche) oder Tumoren hilfreich.
Wie kann man die Hammerzehen behandeln?
Was kann ich gegen Hammerzehen und Krallenzehen selbst tun?
Die konservative Therapie bei Hammer- und Krallenzehen beinhaltet:
- Änderung des Schuhwerks
- Fußgymnastik
- Hilfsmittel
Änderung des Schuhwerks. Man sollte enge, zu kurze Schuhe sowie Schuhe mit hohem Absatz vermeiden. Die Schuhe sollten eine Nummer größer gewählt werden (1 cm länger als der längste Zeh) und sollten über einen räumigen, weichen Zehenraum verfügen. Bei fixierten Fehlstellungen empfehlen sich das Tragen von offenen Schuhen (z.B. Sandalen).
Fußgymnastik. Manuelle Dehnungen der Zehengelenke helfen die Zehenbeweglichkeit zu erhalten. Übungen zur Kräftigung der Fußmuskulatur können das Muskelgleichgewicht wiederherstellen. Eine Übung ist das Heben von Gegenstände (z.B. Bleistift) mit den Zehen. Eine andere gängige Übung ist “die Raupe”. Mit dem Fuß auf einem Tuch flach angelegt versucht man durch die Beugung der Zehen Falten in einem Tuch zu machen.
Hilfsmittel. Solange der Zeh passiv streckbar ist, kann man durch Verwendung verschiedener Hilfsmittel (z.B. Zehenspreizer) eine Linderung erzielen. Wenn der Zeh in Beugestellung fixiert ist, kommen verschiedene polsternde Hilfsmittel (z.B. Polsterschläuche) zum Einsatz.
Alle oben genannten Methoden verzögern eine Weiterentwicklung der Fehlstellung, können jedoch dies nicht stoppen. Wenn alle konservativen Maßnahmen fehlschlagen, besteht die Indikation zur operativen Korrektur.
Operationen bei Hammer- und Krallenzehen
Alle Arten und Schwierigkeitsgrade der Kleinzehenfehlstellungen werden in unserer Einrichtung minimalinvasiv korrigiert.
Die noch passiv streckbaren Hammerzehen (med. flexible Hammerzehe) werden durch minimalinvasive Tenotomie der kurzen Beugersehne adressiert. In anderen Einrichtungen eine offene Korrektur bzw. die Verlagerung der Beugesehne (Operation nach Girdlestone-Taylor) präferiert. Hier wird die lange Beugersehne als Schlinge oben auf dem Zeh vernäht, dadurch wird ein Streckeffekt im PIP-Gelenk erzeugt.
Bei den kontrakten (fixierten) Hammerzehen ist eine knöcherne Korrektur erforderlich. Die minimalinvasive Hammerzehenkorrektur umfasst eine Tenotomie der kurzen Beugersehne sowie perkutane Umstellungsosteotomien. Hier werden durch kleine Schnitte mit einer speziellen Fräse die Zehenknochen an zwei Stellen durchtrennt, die Zehe wird dann manuell geradegestellt und bis zur knöcherner Verheilung mit Tapeverband fixiert.
Andere Kollegen präferieren für die fixierten Hammerzehe offene operative Methoden wie PIP-Resektionsarthroplastik nach Hohmann oder PIP-Arthrodese.
Die Krallenzehen werden wie die Hammerzehe korrigiert, zusätzlich wird hier die lange Strecksehne minimalinvasiv durchtrennt.
Die Malletzehe werden durch eine minimalinvasive Arthrodese des DIP-Gelenkes adressiert.
Häufige Fragen (FAQ)
Wie bekomme ich eine Druckstelle am Zeh weg?
Das Management von Druckstellen am Zeh erfordert in der Regel konservative Maßnahmen, um den Druck zu reduzieren und die Heilung zu fördern. Hier sind einige Tipps, wie Sie eine Druckstelle am Zeh behandeln können:
- Vermeiden Sie weiteren Druck: Identifizieren Sie die Ursache des Drucks und versuchen Sie, diesen zu vermeiden. Dies kann das Tragen von zu engem Schuhwerk oder Schuhen mit zu hohen Absätzen einschließen. Wählen Sie Schuhe mit ausreichend Platz für die Zehen und einer breiten Zehenbox.
- Polsterung: Verwenden Sie Polster oder Schutzpflaster, um den betroffenen Zeh vor weiterem Druck zu schützen. Es gibt spezielle Gel-Polster, Schaumstoffeinlagen oder Moleskin-Pflaster, die als Barriere zwischen dem Zeh und dem Schuh dienen können.
- Ruhe und Entlastung: Reduzieren Sie den Druck auf den betroffenen Zeh, indem Sie ihn entlasten. Tragen Sie bequeme Schuhe und vermeiden Sie es, auf den Zehen zu stehen oder übermäßige Belastungen zu verursachen.
- Feuchtigkeit und Sauberkeit: Halten Sie den betroffenen Bereich sauber und trocken, um das Risiko von Infektionen zu minimieren. Verwenden Sie milde Seife und lauwarmes Wasser, um den Zeh zu reinigen.
Warum verformen sich die Zehen im Alter?
Die Deformität der Zehen im Alter kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, die oft in Kombination auftreten. Mit dem Alter kann eine allgemeine Abnahme der Muskelkraft und -tonus auftreten. Dies betrifft auch die Muskulatur in den Füßen. Wenn die Muskeln schwächer werden, können sie ihre Funktion, die Zehen in einer neutralen Position zu halten, nicht mehr so effektiv erfüllen. Gleichzeitig kann das Bindegewebe steifer werden, was zu einer eingeschränkten Beweglichkeit der Gelenke führt. Der Verschleiß der Gelenke und des Knorpels, der mit dem Alter auftritt, kann zu degenerativen Veränderungen führen. Dies kann die Struktur und Funktion der Gelenke beeinträchtigen und dazu beitragen, dass die Zehen sich verformen.Die Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die mit dem Alter häufiger auftritt. Sie kann Gelenke schädigen und zu Verformungen führen. Auch die Zehengelenke können betroffen sein. Jahrelanges Tragen von schlecht sitzendem oder zu engem Schuhwerk kann die Zehen in eine unnatürliche Position zwingen und zu Verformungen beitragen. Die genetische Veranlagung spielt eine Rolle bei der Anfälligkeit für bestimmte Fußdeformitäten. Menschen, deren Familienangehörige Zehenprobleme hatten, können selbst anfälliger sein. Mit dem Alter nimmt die Elastizität des Bindegewebes ab, was zu einer eingeschränkten Beweglichkeit der Gelenke führen kann.
Welcher Arzt behandelt Hammerzehe und Krallenzehe?
Der Arzt, der Hammerzehen und Krallenzehen behandelt, ist in der Regel ein Orthopäde oder ein Fußspezialist. Diese Fachärzte haben eine spezielle Ausbildung und Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen und Deformitäten des Bewegungsapparats, einschließlich der Zehen. Ein Podologe (medizinischer Fußpfleger) hingegen ist kein Arzt, sondern ein ausgebildeter Fachmann, der bei Hammerzehe Hornhautabtragung durchführt und ggf. Orthosen aus Zweikomponentenmasse modelliert.
Was ist der Unterschied zwischen Hammer- und Krallenzehe?
Der Hauptunterschied zwischen Hammerzehen und Krallenzehen liegt in der Position der betroffenen Gelenke und der Art der Krümmung.
- Bei Hammerzehen ist das Grundgelenk (MTP) und das Endgelenk (DIP) in normaler Stellung Zehe nach oben gebogen, während das Mittelgelenk (PIP) gebeugt ist.
- Bei Krallenzehen hingegen sind sowohl das Mittelgelenk (PIP) als auch das Endgelenk (DIP) gebeugt, während das Grundgelenk (MTP) in Streckfehlstellung befindlich ist.
Welche Übungen bei Krallenzehen?
Hier sind jedoch einige allgemeine Übungen, die bei Krallenzehen hilfreich sein können. Es ist wichtig zu beachten, dass vor Beginn eines Übungsprogramms bei Krallenzehen oder anderen Zehendeformitäten immer Rücksprache mit einem Arzt oder einem spezialisierten Physiotherapeuten gehalten werden sollte. Diese Fachleute können eine genaue Beurteilung der individuellen Situation vornehmen und individuelle Übungen empfehlen, die den Bedürfnissen des Einzelnen entsprechen.
- Zehenstrecken: Setzen Sie sich bequem hin und strecken Sie Ihre Beine vor sich aus. Greifen Sie mit den Händen nach den Zehen und ziehen Sie sie sanft in Richtung Schienbein. Halten Sie diese Position für etwa 15-30 Sekunden und wiederholen Sie dies mehrmals.
- Handtuchübung: Legen Sie ein Handtuch auf den Boden und setzen Sie sich auf einen Stuhl. Greifen Sie mit den Zehen das Handtuch und ziehen Sie es in Richtung Ihres Körpers. Dies hilft, die Muskulatur an der Unterseite der Füße zu stärken.
- Zehenkrallen und spreizen: Setzen Sie sich auf einen Stuhl und lassen Sie Ihre Füße flach auf den Boden. Krallen Sie dann die Zehen ein, indem Sie sie in Richtung Boden bewegen, und halten Sie diese Position für einige Sekunden. Danach spreizen Sie die Zehen so weit wie möglich und halten Sie auch diese Position. Wiederholen Sie dies mehrmals.
- Marbel-Pick-Up: Streuen Sie kleine Kugeln oder Murmeln auf den Boden und setzen Sie sich hin. Verwenden Sie Ihre Zehen, um die Kugeln vom Boden aufzuheben und in einen Behälter zu legen. Dies fördert die Beweglichkeit und Kontrolle der Zehen.
- Fußmassage mit einem Golfball: Setzen Sie sich auf einen Stuhl und rollen Sie einen Golfball unter dem Fußballen und den Zehen. Dies kann helfen, Verspannungen zu lösen und die Beweglichkeit der Zehen zu verbessern.
Warum bekommt man Hammerzehe?
Hammerzehen entstehen durch eine Kombination verschiedener Faktoren, und es gibt nicht immer eine eindeutige Ursache. Die Entstehung von Hammerzehen wird durch genetische, biomechanische und schuhbedingte Faktoren beeinflusst. Hier sind einige der Hauptursachen:
- Genetische Veranlagung: Eine familiäre Veranlagung kann dazu führen, dass bestimmte Patienten anfälliger für Fußdeformitäten wie Hammerzehen sind. Eine genetische Prädisposition kann die Struktur der Füße beeinflussen, was die Entwicklung von Zehendeformitäten begünstigen kann.
- Begleitende Fußfehlstellungen: bei Patienten mit Hallux valgus verdrängt die Großzehe die kleinen Zehen und zwingt sie sich zu beugen. Durch die fehlerhafte Belastung des Fußes bei Patienten mit Hallux valgus wird das Gewicht auf die kleinen Zehen übertragen und die Entstehung der Hammerzehe oder Krallenzehe begünstigen. Durch die ursächliche Muskelschwäche entwickeln Patienten mit Hohlfüßen fast immer Krallenzehe.
- Falsches Schuhwerk: Das Tragen von Schuhen mit zu schmalen Zehenboxen oder zu hohen Absätzen kann den Zehen Druck und Zwangshaltungen aufzwingen. Enges Schuhwerk kann die Zehen zusammendrücken und zu einer unnatürlichen Krümmung führen.
- Muskelungleichgewicht und Schwäche: Ein Ungleichgewicht in der Muskulatur und Sehnen, insbesondere der Muskeln, die die Zehen beugen und strecken, kann dazu führen, dass die Zehen ihre normale Ausrichtung verlieren. Eine Schwäche in den Muskeln, die die Zehen strecken (Extensoren), kann zu einer Beugung der Zehen beitragen.
- Alter: Die Neigung zu Hammerzehen nimmt mit dem Alter zu. Mit zunehmendem Alter können Muskeln, Sehnen und Bänder an Elastizität und Flexibilität verlieren, was die Entstehung von Zehendeformitäten begünstigen kann.
- Fußverletzungen: Verletzungen oder Traumata am Fuß, insbesondere an den Zehen, können das Risiko für Hammerzehen erhöhen.
- Arthritis: Entzündliche Gelenkerkrankungen wie Arthritis können zu Veränderungen in den Gelenken führen und die Entwicklung von Hammerzehen begünstigen.

Frau Anna Peysang
Dr.-medic Melanie Selle